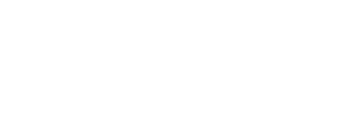Es müssen nicht immer Weltraumschlachten oder Zombieapokalypsen in fotorealistischer Grafik sein. Fernab der großen Publisher gibt es eine Videospielkultur der Traurigkeit und Nachdenklichkeit, der Erinnerung und der Langsamkeit zu entdecken. Diese drei Spiele von kleinen Studios und unabhängigen Entwicklern bieten tiefgründige Geschichten, dichte Atmosphären und ein feines Gespür für Melancholie.
Celeste: Vom Kampf gegen Gipfel
Dieses 2D Jump&Run in charmanter Retro-Pixelgrafik ist gerade das wohl meistgelobte Indie-Game – ein Liebling von Spielern wie von Kritikern. Dabei ist es gar nicht so leicht zu erklären, was dieses Spiel so großartig macht. Auf den ersten Blick ist Celeste einfach ein handwerklich ausgezeichnetes Hüpfspiel: abwechslungsreiches Leveldesign, nostalgisches Artwork, dazu ein hypnotischer Soundtrack. Aber erst die bewegende Geschichte und die liebevollen Charaktere machen Celeste zu einem Juwel. Mit den begrenzten Möglichkeiten des Genres werden hier Themen behandelt, die in Mainstream-Spielen selten zu finden sind.
Die Heldin des Spiels, eine junge Frau namens Madeline, hat es sich zum Ziel gemacht, ganz auf sich allein gestellt den namensgebenden Berg Mount Celeste zu erklimmen. Dabei stellen sich nicht der Wind und die Schwerkraft als ihre größten Herausforderungen heraus, sondern ihre inneren Dämonen. Madeline kämpft mit Selbstzweifeln, mit Depressionen und Panik-Attacken. Der mystische Mount Celeste bringt ihre düstersten Anteile zum Vorschein, sodass Madeline während ihres Aufstiegs von der Manifestation ihrer Ängste, ihrem unheimlichen und dauer-wütenden Alter Ego, verfolgt wird.
Celeste ist spielerisch durchaus anspruchsvoll. Die Level erfordern viel Geschick, präzises Timing und: ständiges Sterben (bei uns waren es 1837 Tode in knapp neun Stunden). Aber für dieses Scheitern wird man nicht bestraft, sondern vom Spiel ausdrücklich gelobt und ermutigt. Deshalb: Hinfallen, Aufstehen, Zähneknirschen, Weiterklettern. Das kann frustrierend sein – zuweilen zum Controller wegwerfen frustrierend. Doch wie sollte ein Kampf gegen innere Dämonen auch anders sein, als frustrierend?
Dabei hält der Berg keine Herausforderungen bereit, die nicht mit genügend Übung, Planung und Beharrlichkeit zu meistern wären. Wem das gelingt, der wird nicht nur mit dem Ausblick vom Gipfel belohnt, sondern mit einer überraschend bedeutsamen Erzählung, die noch lange in Erinnerung bleibt.
Firewatch: Hundert Tage Einsamkeit
Man könnte Firewatch als eine Art „Arthouse-Film“ unter den Videospielen bezeichnen. Das Spiel erzählt die Geschichte von Henry, der im Sommer 1989 einen Job als Feuerwächter in einem abgelegenen Wachturm im Shoshone Nationalpark in Wyoming annimmt. Das Leben dieses Mittvierzigers ist nach der frühen Alzheimer-Erkrankung seiner Frau völlig aus den Fugen geraten. Jetzt will Henry in der Abgeschiedenheit der Wildnis seinem Schmerz, seiner Überforderung und seiner Verantwortung entfliehen – einen ganzen Sommer lang den Horizont nach Waldbränden absuchen, Bücher lesen und seine Gedanken auf einer Schreibmaschine niederschreiben.
Das klingt zugegebenermaßen erstmal nicht besonders aufregend. Doch im Laufe der sechs-stündigen Story entwickelt sich ein packendes und atmosphärisches Abenteuer im vermeintlichen Natur-Idyll. Denn mysteriöse Dinge geschehen in diesem Nationalpark – eine große Verschwörung oder die psychischen Folgen der Isolation? Glücklicherweise ist Firewatch gerade kein Horror-Game, verliert sich nicht im Übersinnlichen oder Phantastischen, sondern bleibt im Kern eine sehr erwachsene Meditation über Einsamkeit und Verlust.
Firewatch kommt ohne Kämpfe und ohne herausfordernde Kletterpartien oder Rätsel aus. Stattdessen streift man in der Ego-Perspektive durch pittoreske Landschaften – in einer einzigartigen Comic-Grafik, die so manches „Triple A-Game“ und so manchen Landschaftsmaler gleichermaßen neidisch machen kann. Allein um die Naturimpressionen, die Sonnenuntergänge, Nebelschwaden und weit entfernten Wetterleuchten zu bestaunen, lohnt es sich, Firewatch zu spielen.
Völlig isoliert bleibt Henry allerdings nicht: Die einzige menschliche Verbindung des Spiels ist die zu Delilah, Henrys Vorgesetzter, die in einem entfernten Wachturm (für den Spieler gerade noch am Horizont erkennbar) ebenfalls als Feuerwächterin arbeitet. Allein über das Walkie-Talkie können sich die Beiden austauschen. Die klug geschriebenen und ausgezeichnet eingesprochenen Dialoge – die der Spieler mitgestalten muss – führen durch die gesamte Erzählung. Dabei entsteht eine der innigsten Beziehungen, die man zu einem computergesteuerten Charakter nur aufbauen kann.
Night in the Woods: Das Unbehagen in der amerikanischen Kleinstadt
Mae Borowski ist 20 Jahre alt, hat gerade ihr Studium abgebrochen und wohnt nun wieder bei ihren Eltern, in ihrem alten Kinderzimmer auf dem Dachboden. Zurück in „Possum Springs“; zurück in der Kleinstadt ihrer Kindheit, die ihr nun so merkwürdig fremd erscheint. Arbeitslosigkeit ist das vorherrschende Thema auf den Straßen, seit die lokale Kohlemine stillgelegt wurde, viele Geschäfte mussten schließen und zu Maes Ärger ist die ganze Stadt ein einziges Funkloch. Die Beziehung zu Maes Eltern ist nicht mehr das, was sie mal war. Und ihre alten Freunde sind einfach ohne sie erwachsen geworden, während Mae noch damit hadert, einen Platz im Leben zu finden. Ach, ein nebensächliches Detail: Mae ist eine niedliche anthropomorphe Katze in einer Welt voller niedlicher anthropomorpher Tiere.
Night in the Woods ist ein Story-basiertes 2D-Abenteuerspiel und erzählt eine sehr moderne „Coming-of-Age“ Geschichte. Ein wirkliches Ziel oder eine Mission gibt es in diesem Spiel nicht. Neben einigen Mini-Games und Erkundungsmöglichkeiten gibt es eine Haupthandlung, die wie ein interaktiver Comic durch das Spiel führt. Als Mae verschläft man regelmäßig halbe Tage, hängt mit alten Freunden in der Pizzeria ab, spielt Bass in einer Garagen-Rockband oder trinkt auf einer Party am Stadtrand zu viel Bier und muss sich dann ausgerechnet vor dem Ex-Freund übergeben. Man schlägt sich mit wirren Albträumen rum und erfährt nach und nach mehr über die Vergangenheit einer der vielschichtigsten Protagonistinnen in der Videospiele-Geschichte.
Neben der entzückend lässigen Indie-Ästhetik dieser detailverliebten Spielwelt sind es vor allem die großartigen Dialogie (leider nur in Textform), die Night in the Woods zu etwas ganz und gar Einzigartigem machen: viel Slang und viel Millennial-Humor, immer irgendwie wortwitzig und tiefgründig zugleich. Mit ihren Freunden Gregg, Bae und Angus spricht Mae über Bands oder Computerspiele, streift dann aber immer wieder auch Themen wie psychische Gesundheit, Entfremdungserfahrungen, Kindesmissbrauch oder Sinnkrisen. Diese Motive drängen sich jedoch niemals auf, bleiben stets subtil und können leicht überlesen werden, wenn man nicht aufmerksam bleibt.
Zwar baut auch Night in the Woods im letzten Drittel des Spiels eine rätselhafte, etwas verwirrende, Gruselgeschichte auf. Aber wer hier eine weltbewegende Story erwartet, wird endtäuscht. Die Stärken des Spiels liegen in der authentischen Darstellung zwischenmenschlicher Beziehung; in der spürbaren Melancholie der Kleinstadt-Rückkehr einer gescheiterten Antiheldin. Das ist für ein Videospiel ungewohnt entschleunigend, an manchen Stellen etwas langatmig. Aber so ist es nun mal, das kriselnde Katzendasein in der Kleinstadt.