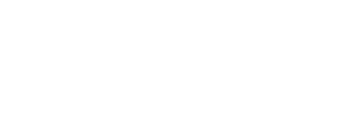Der Kampf gegen die Klimakrise läuft nur schleppend an. Ein Grund dafür ist die ungünstige Öffentlichkeitsarbeit. Zeit, die (Bild-)Sprache des Klimaschutzes zu überdenken.
Schon der Begriff ist äußerst unglücklich: Klimawandel. Das klingt harmlos – ja, vielleicht sogar wünschenswert. Denn Wandel ist doch schließlich etwas Natürliches und Unaufhaltbares. Tatsächlich unterliegt das Klima einem ständigen Wandel, seit es den Planeten gibt – Eiszeiten und Warmzeiten hat es schon gegeben, lange bevor wir Menschen uns auf der Erde ausgebreitet haben. Da wäre es doch vermessen, sich dem unaufhaltsamen Lauf der Natur in den Weg stellen zu wollen.
Erderwärmung trifft es schon besser, bleibt aber dennoch euphemistisch. Denn zumindest hierzulande scheint niemand etwas gegen ein bisschen mehr Wärme zu haben. Ein paar Grad wärmer? Für viele klingt das nicht nach einem Bedrohungsszenario, sondern mehr nach einem Versprechen für die nächste Badesaison.
Die Krise beim Namen nennen
Weder Klimawandel noch Erderwärmung schaffen es, Ausmaß und Dringlichkeit, von dem, was uns und unserem Planeten bevorsteht, begrifflich einzufangen. Vielmehr müssten wir von einer Klimakrise sprechen. Denn wir haben es nicht mit einem natürlichen Prozess, sondern mit einem menschengemachten Problem zu tun – einer globalen ökologischen wie politischen Krise. Und statt von der Erderwärmung sollte von einer Erderhitzung die Rede sein. Denn der Begriff der „Erwärmung“ schafft es nicht, zu verdeutlichen, welche dramatischen Auswirkungen allein zwei oder drei Grad Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur hätten: Dürren und Wasserknappheit, Überschwemmungen und Stürme, schmelzende Polkappen und ein gravierender Verlust der biologischen Vielfalt.
Die Tragweite dieser klimatischen Veränderungen muss sich auch in der Sprache wiederfinden. Wie das geht, hat die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg gerade vorgemacht, als sie auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos mahnte: „Ich will nicht eure Hoffnung. Ich will, dass ihr in Panik geratet.“ Dass sie den richtigen Ton getroffen hat, merkt man daran, wie viele Klimaleugner und Rechtspopulisten sich Online über sie empören.
Es geht nicht um die Eisbären
Die Bildsprache des Klimaschutzes macht leider auch keinen besseren Job. Das Titelbild von gefühlt jedem zweiten Artikel oder NGO-Bericht über die Klimakrise zeigt einen Eisbären, der einsam und verloren auf einer Scholle durch das Polarmeer treibt. Immer wieder der Eisbär. Das sind wunderschöne und beeindruckende Raubtiere – keine Frage. Eine Welt, in der es noch Eisbären gibt, ist einer Welt ohne sie gewiss vorzuziehen.
Aber der Eisbär ist als effektives Symbol für die Klimakrise denkbar ungeeignet. Denn die Wahrheit ist: Diese Tiere leben sehr weit weg und die Allerwenigsten werden je einen Eisbären außerhalb eines Zoos zu Gesicht bekommen. Mag auch der Fortbestand der Eisbären untrennbar mit dem Klimawandel verbunden sein – unsere Existenz hängt nicht vom Fortbestand der Eisbären ab.
Wenn es nicht die Eisbären sind, dann sind es Bilder von verdorrten Landschaften in Afrika oder von überschwemmten Inseln im Südpazifik. Doch auch das scheint für einen Mitteleuropäer oder Nordamerikaner unendlich weit weg und nicht unmittelbar existenzbedrohend zu sein. Außerdem bürgen solche Motive immer auch ein Risiko der Gewöhnung, der resignativen Abstumpfung.
Vor allem aber schaffen es die Bilder von Eisbären und verdorrten Böden nicht, einen der wichtigsten Aspekte des globalen Temperaturanstiegs zu illustrieren: Die Klimakrise wird keine rein ökologische Krise bleiben – sie wird verheerende humanitäre Konflikte zur Folge haben: Ernteausfälle, Hunger, Durchfall- und Infektionskrankheiten, Flüchtlingsströme und Kriege.
Neue Bilder für den Klimaschutz
Eine Ikonografie der Klimakrise ist eine diffizile Angelegenheit. Denn die menschengemachte Veränderung des Klimas ist in vielerlei Hinsicht ein komplexes und abstraktes Problem – langwierig, global und transgenerational. Im Gegensatz zum Wetter lässt sich das Klima nicht unmittelbar erfahren oder beobachten. Die Überhitzung des Planeten ist zudem nicht monokausal – sie hat nicht die eine, sondern viele verschiedene Ursachen. Diese Abstraktionen können eine gefährliche psychologische Distanzierung bewirken: Es kann sich anfühlen, als sei das alles weit weg und noch lange hin.
Auf der Suche nach effektiven Motiven für den Klimaschutz hat der britische ThinkTank „Climate Outreach“ eine Studie dazu vorgelegt, welche Illustrationen der Klimakrise welche Gefühle und Reaktionen beim Betrachter hervorrufen. Die Ergebnisse: Fotos von Eisbären und schmelzenden Gletschern werden zwar treffsicher mit der Klimakrise in Verbindung gebracht, bewegen den Betrachter jedoch kaum zum Nach- oder Umdenken – sie sind abgenutzt, haben ihre Wirkung verloren. Fotos von Demonstrationen und Klima-Aktivistinnen stoßen lediglich im grünen Milieu – bei den ohnehin schon Überzeugten – auf Zustimmungen. Bei der Mehrheit der Betrachter rufen sie dagegen Ablehnung oder Zynismus hervor.
Auch mit Bildern von Naturkatastrophen sollte sparsam umgegangen werden. Wie die Studie nahelegt, können die zwar durchaus emotional sehr wirksam sein, aber ebenso leicht Gefühle der Ohnmacht, der Hilflosigkeit und Resignation hervorrufen. Wenn, dann sollten die Fotos weniger weit entfernte Klimafolgen und mehr regionale Auswirkungen zeigen. Bilder, die sagen: Die Klimakrise ist jetzt und hier.
Die Forscherinnen und Forscher von Climate Outreach empfehlen vor allem neue und unverbrauchte Motive für den Klimaschutz. Ungewohnte visuelle Narrative, die dabei helfen, die Klimakrise unter einem neuen Aspekt zu betrachten. Das können auch positive Darstellungen sein: Bilder, die von Klima- und Umweltschutz, von erneuerbaren Energien, erzählen. Besonders wirksam sollen solche Bilder sein, wenn darauf außerdem noch Menschen in authentischen, nicht gestellten Situationen zu sehen sind.

Foto: © Raimond Spekking (via Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0
Die rhetorischen Vorteile der Klimaleugner
Die öffentliche Wahrnehmung der Klimakrise hat noch ein ganz anderes Problem: die Sprache der Wissenschaft. Im medialen Diskurs haben Klimaforscher häufig einen berufsbedingten Nachteil gegenüber Klimaleugnern. Denn der redliche Wissenschaftler benutzt Vorsichtsfloskeln wie „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ oder „nach derzeitigem Stand der Forschung“. Er hält sich zurück, wenn es darum geht, einzelne Wetterphänomene kausal mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen und widersteht der Versuchung, allzu simple globale Klima-Prognosen aufzustellen.
Die Klimaleugner sind da klar im Vorteil. Denn sie müssen sich nicht mit lästigen Fakten und Belegen rumschlagen. Sie können mit der ganzen Bandbreite rhetorischer Mittel arbeiten, wie es ihnen beliebt. Auf Redlichkeit und Fairness müssen sie nicht achten. Zu ihrem Repertoire gehört der überzogene Vergleich („Der Klimaschutz ist doch bloß ein moderner Religionsersatz“) und die unsachliche Polemik („Ökofaschismus? Nein, danke!“). Besonders beliebt bei Klimaleugnern sind die sogenannten ad hominem Argumente. Statt inhaltlich auf die Argumente der Klimaforscher einzugehen, werfen sie ihren Gegnern Heuchelei vor und greifen sie persönlich an („Schaut mal, der Robert Habeck von den Grünen reist doch selber mit dem Flugzeug“).
Die Klimaleugner können Klima und Wetter beliebig durcheinanderwerfen, wie es ihnen gerade passt. Ist es im Winter kälter als üblich, reicht ihnen das als Widerlegung der Erderwärmung. So twitterte kürzlich Donald Trump anlässlich des extremen Wintereinbruchs in den USA: „Was zur Hölle ist mit der Erderwärmung los? Bitte komm schnell zurück, wir brauchen Dich!“
In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. Januar 2019
Zu oft wurde in den vergangenen Jahren der Fehler gemacht, in Zeitungsartikeln und Talkshows Klimaforschern und Klimaleugnern gleichermaßen eine Bühne zu geben. So kann leicht der Eindruck entstehen, bei den Fachleuten herrsche Uneinigkeit, was das Klima betrifft. Erfreulicherweise hat sich hier einiges getan: Mehrere Metastudien konnten zeigen, dass sich 90 bis 100 Prozent aller aktiven Klimaforscher einig sind, dass es eine menschengemachte Klimakrise gibt. Und dass die klimatischen Veränderungen sehr bedrohlich sind, ist mittlerweile bei einem Großteil der Weltbevölkerung angekommen.
Der trockene Hitzesommer in Deutschland 2018 hat etwas geschafft, was Klimaschutzkampagnen nur selten gelingt: Plötzlich war die Klimakrise in aller Munde. Die Berichterstattung nahm deutlich zu, genauso wie die Suchanfragen mit dem Wort „Klimawandel“ auf Google. „Hitzesommer“ wurde von der Gesellschaft für Deutsche Sprache zum Wort des Jahres gekürt und Deutschland diskutierte über Dürre-Schäden und Ernteausfälle. Auf einmal war die Klimakrise gar nicht mehr so abstrakt und weit weg, sondern hier und jetzt.